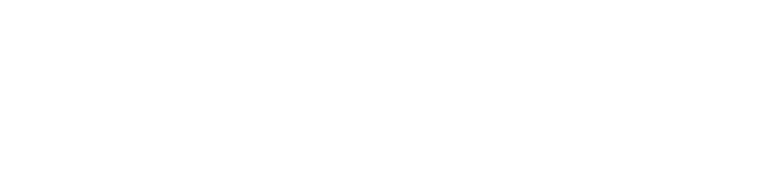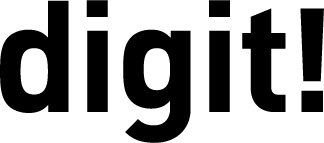„Erst denken – dann fotografieren“
Der Coach und Fotograf Rüdiger Schrader über die kreativen und monetären Effekte seines „Visuell denken“-Konzepts und die Frage, warum Fotografen mehr auf das achten sollten, was hinter der Kamera passiert.

Von Peter Schuffelen
Herr Schrader, als Coach helfen Sie Kreativen, sich weiterzuentwickeln, dazu propagieren Sie das Prinzip des visuellen Denkens. Was meinen Sie damit?
Rüdiger Schrader: Visuell denken bedeutet: Geh von einem Bild in deinem Kopf aus, und nutze dieses als Basis für deine kreativen und kommunikativen Prozesse. Es geht dabei um den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Sehen und Denken. Wer in Bildern denkt, kann so Sprachbilder entwickeln und dadurch Inhalte besser vermitteln – anderen, aber auch sich selbst.
Wie profitiere ich als Bilderschaffender konkret?
RS: Kurz gesagt: Visuelles Denken führt zu visueller Intelligenz, das ist die Basis für Kreativität und Innovationen – und damit auch für kommerziellen Erfolg.
Wie und warum haben Sie dieses Konzept entwickelt?
RS: Als ehemaliger Chef-Fotograf bei dpa und als Fotochef beim Stern und beim Focus war ich kontinuierlich mit der Frage konfrontiert, wie ich eine bestimmte Geschichte visuell umsetze und welchen Fotografen ich dazu beauftrage. Ich habe gelernt, dass ich am effektivsten bin, wenn ich ein Leitbild zunächst in meinem Kopf visualisiere, das dann in ein Wortbild fasse und dieses dann für das redaktionelle Konzept bzw. die Briefings nutze.
Dazu muss ich allerdings das „richtige“ Bild vor Augen haben.
RS: So ist es. Besonders deutlich ist mir das noch mal geworden, als Genscher 1989 mit dem Zug nach Prag reiste, wo er in der Botschaft seine berühmte Ansprache hielt. Ich war damals Fotochef beim stern und habe dem Fotoreporter Jürgen Müller-Schneck gesagt: Der Zug fährt durch die DDR und hält genau einmal, nämlich in Dresden. Ich wette, die Volkspolizei wird den Hauptbahnhof abriegeln und sich dabei so einigeln wie die Römer beim Anblick von Asterix und seinen Mitstreitern. Genau so kam es, und am Ende hatten wir die von mir prognostizierten Bilder – die DDR-Staatsmacht, die sich hinter einer Wand aus Schutzschildern versteckt – und das exklusiv. Es geht also darum, Geschehensabläufe zu antizipieren und diese dann in konkrete Bilder zu übersetzen.
Woran hapert es Ihrer Erfahrung nach in der Praxis?
RS: Oft wird aus vermeintlichem Zeitmangel nicht zielgenau kommuniziert. Natürlich kann man auch immer wieder den Pudding an die Wand werfen und warten, bis irgendetwas kleben bleibt. Sinniger ist es aber, sich vorher plastisch vorzustellen, was man will und das dann in Sprachbilder zu fassen. Oft sind das einfach sinnbildliche Akronyme.
Haben Sie ein Beispiel für ein derartiges Sprachbild?
RS: Angenommen, ich will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner als jemanden porträtieren, dessen Öffentlichkeitsbild über die Bilder im normalen Politikbetrieb hinausgeht, dann könnte das Sprachbild in meinem Briefing etwa so lauten: fotografiere das Mannequin der Bauern! Damit hat sofort jeder ein Bild im Kopf. Ein anderes Beispiel: Auf die Frage „Wie visualisiert man die Liebe in Zeiten von Corona?“ könnte ich mit dem Bild eines Paares antworten, das sich mit Masken küsst. Die Vogue Italia hat sich für ein solches Bild entschieden. Man könnte aber auch folgendes Bild entwickeln: ein einsamer Romeo, der am Flughafen strandet und nicht zu seiner Liebsten kann.
Ein starkes Bild – aber gar nicht so leicht zu visualisieren. Wie gibt man da ein konkretes Briefing?
RS: Beispielsweise, indem ich einen Filmklassiker als Analogie nenne, dann wissen 80 Prozent der Leute, was ich meine. Überhaupt gilt ja: Wenn ich mit wirklich guten Fotografen oder Bildredakteuren zusammenarbeite, funktioniert die Kommunikation über Sprachbilder auf Anhieb, weil die alle Werke der großen Fotografen und Filmemacher auswendig kennen und …
Lesen Sie weiter in
-
digit! 4-2020
5,99 € – 6,50 €68 Seiten.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 2-3 Werktage